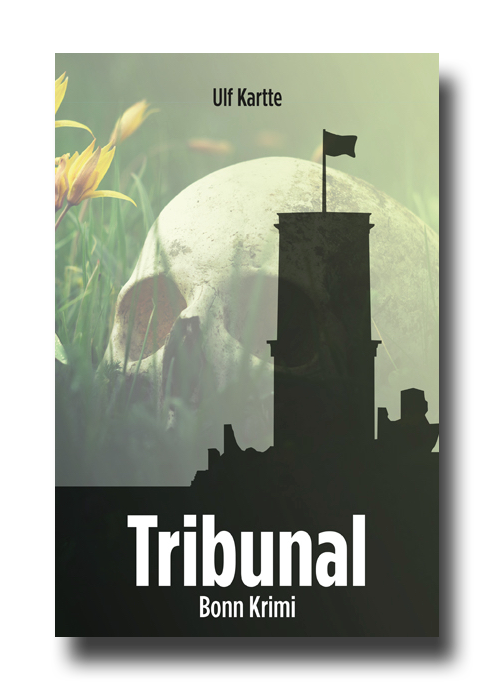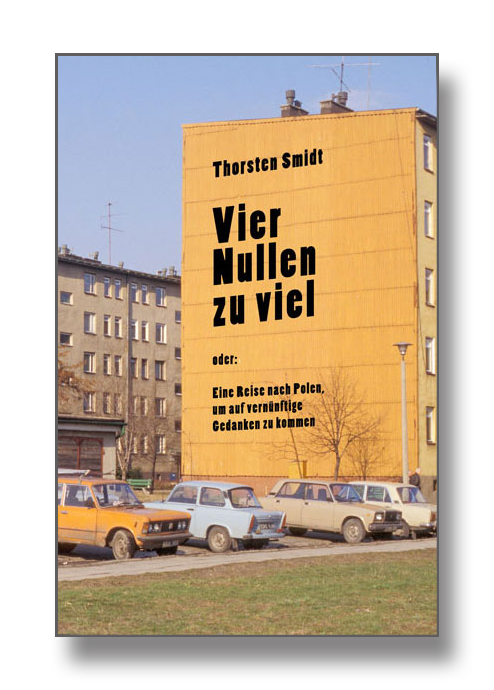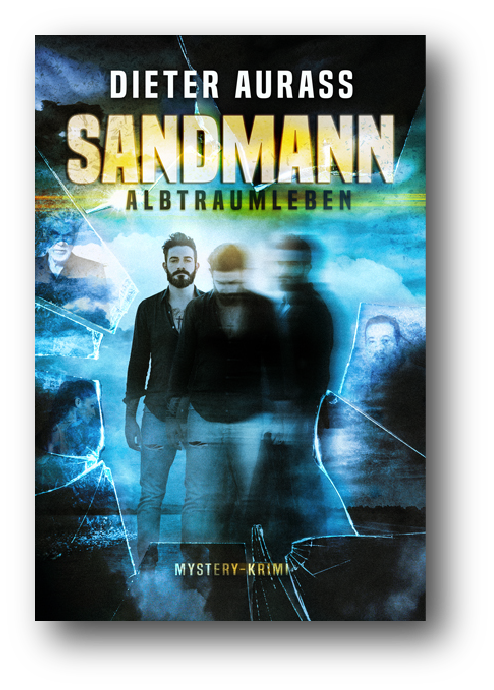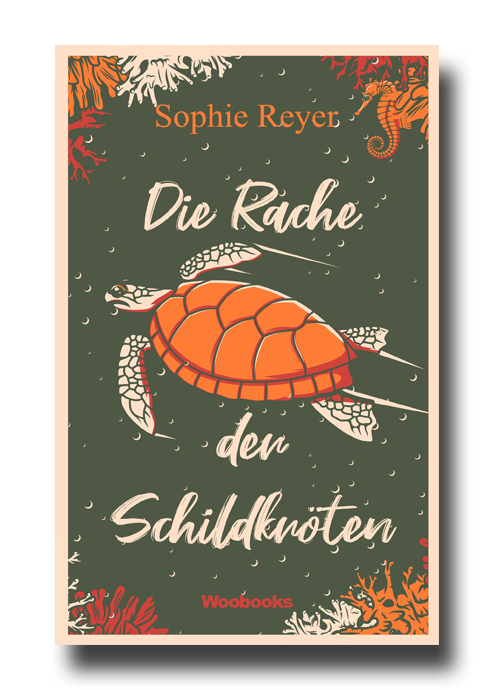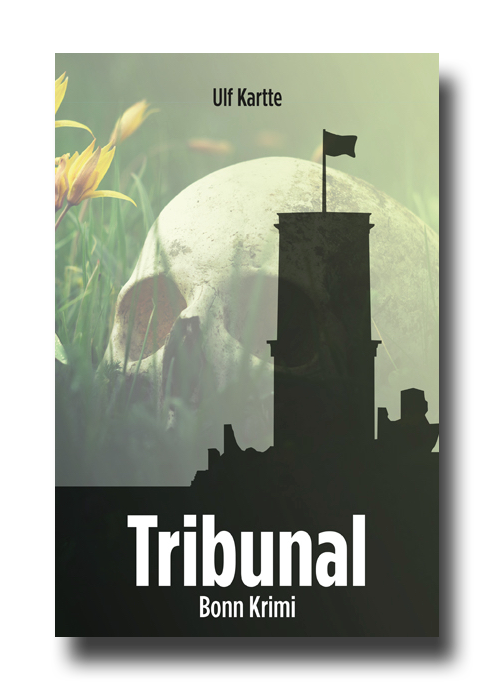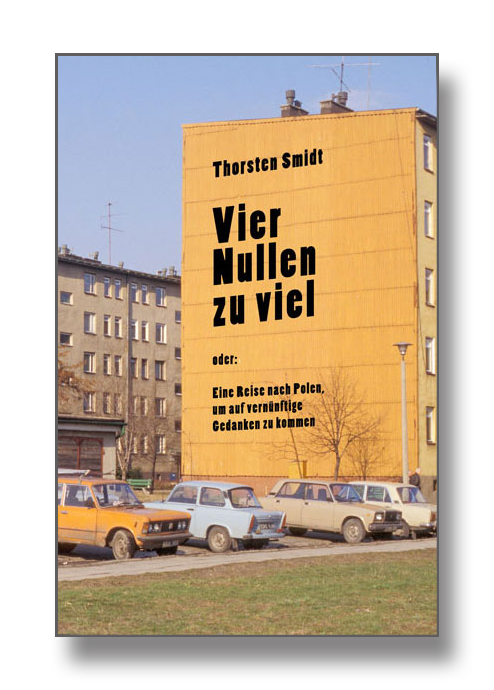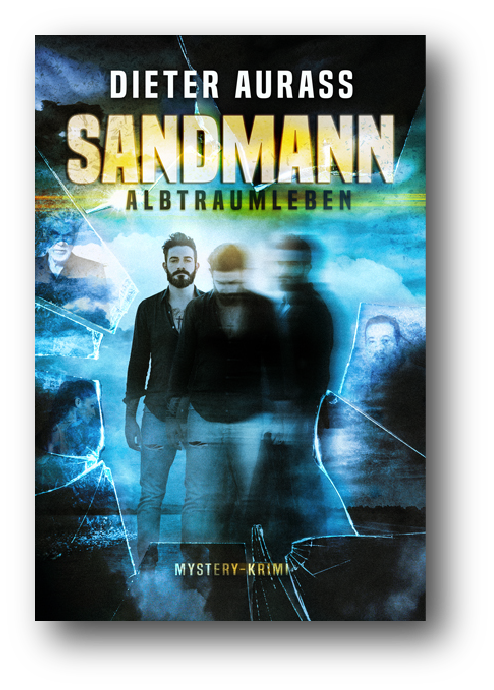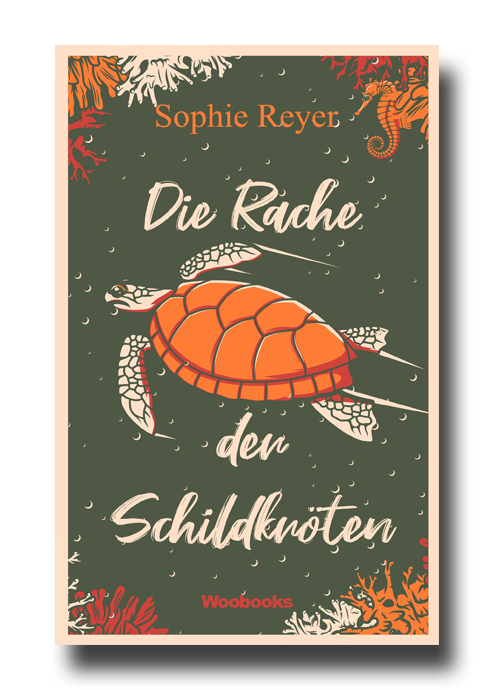Prolog
aus: Tribunal – von Ulf Kartte
Er: »Ich will einen Mord melden.«
Sie: »Wer ist denn umgebracht worden?«
Er: »Bisher niemand.«
Sie: »Was wollen Sie dann melden?«
Er: »Er wird noch ermordet.«
Sie: »Wer?«
Er: »Dario.«
Sie: »Dario?«
Er: »Dario Kovac. Vielleicht schon morgen. Sie müssen etwas tun!«
Halt! Stopp Playback! Sie kam sich vor wie in einem abgedroschenen amerikanischen Film, so etwa wie bei »D.O.A. – Bei Ankunft Mord« mit Dennis Quaid. Soweit sie sich erinnerte, hatte der allerdings seine eigene Ermordung durch ein langsam wirkendes Gift gemeldet, das ihm ein Unbekannter verabreicht hatte.
Nur, dass es kein Film war. Und dass der Mann wirklich vor ihr stand. Und sie völlig durcheinander war. Dabei sah der Fremde, der am Samstag kurz nach sechzehn Uhr die Polizeiwache Bad Godesberg in der Zeppelinstraße betreten hatte, nicht wie ein Spinner aus. Er hatte ein offenes Gesicht, dunkle, schon ein wenig schütteres Haar und einen ernsten Zug um den Mund. Er trug einen zu engen Anzug, der seine gedrungene Statur kaum verbarg. Seine Gesichtszüge deuteten auf eine slawische Abstammung hin. Sie schätze ihn auf Mitte vierzig.
Als wachhabende Beamtin nahm sie Namen und Adresse auf. Sie fragte nach den Umständen der »Tat«. Wer denn der »Mörder« sei? Und warum er diesen Dario umbringen wolle? Und woher er das wisse? Der Mann sah sie an. Seine Mundwinkel zuckten. »Gott weiß es. Und ich weiß es auch. Bitte, Sie müssen etwas tun!«
Polizeimeisterin Hanna Rose hatte genug. Bestimmt erlaubte sich der Besucher einen Scherz mit ihr. Sie war ja nur eine Frau. Sollte sich doch ihr Chef mit diesem Verrückten auseinandersetzen!
Als sie mit Polizeiobermeister Arnd Zeitler zurück zum Empfang kam, war der Besucher verschwunden.
»Was hatte der denn?«, fragte ihr Chef.
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder so ein Irrer, der sich wichtigmachen wollte«, sagte sie und dachte an ihre Tochter, die sie gleich zu einer Geburtstagsfeier nach Beuel auf die andere Rheinseite bringen musste.
.
1
»Rot wie der Tod«, sagte Philipp Antoniou. Er stand vor der Leiche und sah ins Leere. Einen einzigen Blick hatte er auf den Toten geworfen. Dann wandte er sich ab und sah auf den Rhein. Eigentlich blickte er darüber hinweg, so, als könne er am Horizont, über dem eine blutrote Sonne aufging, etwas erkennen, was nur für ihn sichtbar war. Azra Kaya kannte das. In den acht Monaten, in denen sie zusammenarbeiteten, hatte sie häufiger das Gefühl gehabt, dass ihr Chef neben sich stand. Nein, korrigierte sie sich, eher über den Dingen. Als setzte er im Kopf Teile eines unsichtbaren Puzzles zusammen. Das kam wohl von seinem früheren Beruf.
Aber sie wollte ihn in ihrer Welt haben. Azra kniete neben dem Toten nieder, der ein Stück abseits des Rheinuferweges zwischen zwei Bäumen auf dem Boden lag. Unter seiner offenen Jacke trug er ein beiges Hemd. »Sieht nach einer Stichwunde aus«, sagte sie und deutete auf einen Riss auf Höhe der Brust inmitten eines ausgefransten Blutflecks, der ein bizarres Muster auf dem Hemd bildete.
Ohne sich umzudrehen, fragte Philipp: »Wo bleibt die Spurensicherung?«
Sie zuckte mit den Schultern und sah nach oben. In den roten Himmel hatten sich große schwarz-graue Wolken geschoben. Die Spusi musste sich beeilen. Es würde Regen geben.
»Montag, neunter April, sieben Uhr. Rheinufer Mehlem, etwa einhundertfünfzig Meter südlich des Anlegers der Königswinterer Fähre«, diktierte sie in ihr iPhone und speicherte die GPS-Daten ihres Standorts. Am vorletzten Wochenende hatte sie mit einer Freundin eine Fahrradtour am Rhein gemacht. Mit der Fähre waren sie übergesetzt und auf der anderen Seite mit der Zahnradbahn auf den nahen Drachenfels gefahren. Nun stand sie fast an der gleichen Stelle – vor einem Toten. Sie sah ihn an. »Größe etwa ein Meter siebzig, kurze graue Haare, circa sechzig Jahre alt, vermutlich Südosteuropäer«, diktierte sie weiter. Sie blickte sich um. Um sie herum säumten Büsche die Wiese. Wenige Meter neben ihr führte ein schmaler Fußgängerweg zu den hinter Bäumen liegenden Häusern in der Rüdigerstraße. Auf der anderen Seite des Weges lag das abgezäunte Gelände eines Seniorenwohnheims.
Sie zog Handschuhe über und griff in die Taschen des Opfers. Schließlich holte sie aus der linken Hosentasche ein gefaltetes Papier heraus. Vorsichtig glättete sie das Blatt, auf dem untereinander handgeschriebene Wörter standen.
»Und?«, fragte Philipp.
»Das kann ich nicht lesen«, meinte sie enttäuscht.
Er drehte sich um. Sie hielt ihm den Zettel hin. Auf einmal wirkte er konzentriert. Sie sah ihn fragend an.
»Scheint eine serbokroatische Sprache zu sein. Ich verstehe nicht alles. Sieht aus wie eine Einkaufsliste.«
Er drehte sich wieder zum Wasser hin. »Verfluchter Balkan!«, schrie er so laut, dass die Möwe, die ein Stück neben ihnen auf einer Bank saß, erschreckt aufflog.
***
Lagebesprechung, Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße, Raum »Beethoven«, Beginn: 11.10 Uhr. Anwesend: Polizeidirektor Peter Rodenstock, Kriminalhauptkommissar Lars Manke, Kriminalkommissar Sven Heugel, Polizeikommissarin Azra Kaya. Abwesend: Kriminalhauptkommissar Philipp Antoniou.
Während sie warteten und Rodenstock alle paar Sekunden auf die Uhr sah, rekapitulierte Azra für sich, was sie wussten. Laut vorläufigem Befund des Rechtsmediziners Cornelius Meezen war das Opfer zwischen fünf und sechs Uhr morgens durch einen Messerstich getötet worden. Der Angriff musste überraschend erfolgt sein, denn es gab keine Abwehrspuren. Die Wunde, ein etwa drei Zentimeter langer, glattrandiger Schlitz, lag im Brustbereich. Der Täter hatte mit seinem einzigen Stich vermutlich direkt das Herz getroffen. Die Tatwaffe hatte die Spurensicherung nicht gefunden, dafür aber unter einem anderen Gebüsch die Ausweispapiere des Opfers in einem ansonsten leeren Portemonnaie. Der Tote hieß Dario Kovac und war dreiundsechzig Jahre alt. Er hatte einen bosnischen Pass bei sich. Sonst gab es bisher keine brauchbaren Spuren, weder an der Leiche noch am Tatort. Ein Spaziergänger hatte den Toten gefunden, genauer gesagt sein Hund, der sich losgerissen und weg vom Rheinuferweg zu den beiden Bäumen gelaufen war.
Mittlerweile hatte die Unruhe im Raum beträchtlich zugenommen. Heugel rutschte auf dem Sitz herum, Manke spielte mit seinem Smartphone und räusperte sich fortwährend. Und Rodenstock sah Azra mit einem Blick an, der wohl tödlich wirken sollte. »Kommt er, oder kommt er nicht?«, fragte er verärgert. Sie seufzte, klappte ihr iPad auf und fasste die Lage zusammen.
***
Philipp Antoniou saß währenddessen im Garten und streichelte seine Schildkröten. Er liebte die Annettenstraße im Bonner Süden mit ihren kleinen Spielzeughäuschen, zu deren Ensemble seine Drei-Zimmer-Mietwohnung mit Garten gehörte. Und er schätzte die Lage im Bad Godesberger Ortsteil Plittersdorf, fast direkt am Rhein, wenige Meter von der früheren apostolischen Nuntiatur entfernt. Auf dem weiträumigen Anwesen hatte zu Bonner Hauptstadtzeiten die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls in Deutschland ihren Sitz.
»Guten Morgen, Achilles«, sagte er zärtlich, nachdem er sich vergewissert hatte, dass es auch seinen sechs Artgenossen gut ging. Achilles war ein Prachtexemplar einer griechischen Landschildkröte. Mit knapp sechzig Jahren war sie beinahe doppelt so alt wie er. Die Tiere lebten in einem abgezäunten Freigehege, das fast den ganzen Garten einnahm. Er begnügte sich mit der kleinen Veranda, auf die man vom Wohnzimmer aus gelangte und auf der ein alter Holztisch mit vier klapprigen Stühlen stand. Nicht, dass er häufig Besuch bekam. Meistens reichten zwei Sitzgelegenheiten aus, wenn sein Freund Jannis, Halbgrieche wie er, abends auf ein Bier vorbeikam. Dann diskutierten sie über Politik und sprachen über die griechische Heimat, die beide, da sie in Deutschland geboren und aufgewachsen waren, kaum kannten.
Philipp saß auf dem Boden und streichelte Achilles‹ Kopf. Er hatte ihn wie Agamemnon und Hektor vor sechs Jahren von seinem Bruder übernommen. Erst vor wenigen Tagen hatten sie, zusammen mit ihren Artgenossen, ihre Winterruhe beendet.
Er dachte an seinen Bruder. Mit einem Mal überfielen ihn die Erinnerungen. Da waren sie wieder, die Bilder im Kopf, die er nicht loswurde, und die ihn bis in seine Träume verfolgten. Der plötzliche Knall, der ihn meterweit weggeschleudert hatte. Der Moment, in dem er zu sich kam. Der dichte Rauch, der ihn blind machte. Und dann, als er wieder sehen konnte, die Körperteile, die um ihn herum lagen.
Es fing an zu regnen. Philipp stand auf. Er musste sich mit den Lebenden befassen.
***
Der Raum in dem alten Gebäude in der Zagreber Innenstadt hätte mit seiner nichtssagenden Einrichtung auch ins Polizeipräsidium Bonn gepasst: ein großer weißer Besprechungstisch mit zerkratzter Tischplatte, sechs dazu passende Bürostühle (bei einem war eine Armlehne angebrochen), ein weißes Sideboard mit einem fünfundvierzig Zoll-LCD-Fernseher darauf, eine Fernbedienung und ein Konferenztelefon auf dem Tisch. Die Zeiger der Funkwanduhr standen exakt auf dreizehn Uhr. Welten trennten allerdings die Bilder an der Wand: Während den Besprechungsraum »Beethoven« im Polizeipräsidium Bonn in der Königswinterer Straße ein Schwarzweiß-Druck des Komponisten zierte, hing in Zagreb ein Schlachtengemälde mit goldenem Rahmen. »Den Helden der Schlacht von Vukovar« stand darunter. Nach der Niederlage Kroatiens gegen die jugoslawische Armee und serbische Truppen war die Stadt am 18. November 1991 nach monatelanger Belagerung dem Erdboden gleichgemacht worden.
»Za dom spremni, ›General‹«, grüßte Mirko ehrerbietig.
»Für die Heimat - bereit«, gab der Ältere der beiden, der am Tisch sitzend gewartet hatte, den Gruß der faschistischen Ustascha-Bewegung zurück, bevor er ihm bedeutete, Platz zu nehmen. Er war sichtlich geschmeichelt von der Anrede mit seinem Ehrentitel. Beide Männer trugen zivil. Mit ihren Jacketts und weißen Hemden sahen sie aus wie Geschäftsleute, was sie nach außen hin auch waren. »Asseto South Eastern Europe« stand auf dem goldenen Schild neben der Eingangstür, und das wohlsituierte internationale Handelsunternehmen in bester Innenstadtlage hatte sogar einige fest angestellte Mitarbeiter.
Mirko wartete darauf, dass der Ältere das Gespräch begann, doch der »General« schwieg. Unter der Jacke, die er über seinem massigen Oberkörper trug, zeichnete sich die Wölbung eines Schulterholsters ab.
»Wie steht unsere Sache?«, fragte er endlich.
»Der Auftrag hielt mich länger auf als erwartet«, antwortete Mirko. »Dafür ist alles zu unserer Zufriedenheit verlaufen.«
»Das will ich hoffen«, sagte der »General« frostig. »Was ist mit dem Geld?«
»Ich habe es noch nicht«, antwortete Mirko.
»Warum erfahre ich das erst jetzt? Du hattest die Anweisung, dich so schnell wie möglich zu melden. Stattdessen bist du untergetaucht. Als ob du dich vor uns verstecken könntest.«
»Nach Ihrer Nachricht heute Morgen habe ich die nächste Maschine genommen«, entgegnete Mirko.
Der »General« schnitt ihm das Wort ab: »Schweig, ich will nichts hören.«
Er wandte sich ab und blickte auf das Schlachtengemälde an der Wand. Nachdem er sich sattgesehen hatte, stand er auf und ging im Raum umher.
»Die Zeiten haben sich geändert«, sagte der »General«. »Das Land hat sich verändert. Ohne prahlen zu wollen, behaupte ich, dass unsere Organisation einen großen Anteil daran hat.« Er deutete auf das Bild: »Die Schlacht von Vukovar haben wir verloren. Aber das Erbe der Ustascha trägt Früchte. Die Bewegung von 1941 ist heute weitgehend rehabilitiert. Kaum jemand redet noch davon, dass damals in Kroatien Serben, Juden und Roma verfolgt wurden. Nein, der Blick richtet sich auf die große Tat der Gründung eines unabhängigen kroatischen Staates durch die Ustascha. Und auch das Eingreifen in Bosnien in den neunziger Jahren wird heute als das gesehen, was es war: unser legitimes Recht, den kroatischen Staat zu verteidigen. Erstmals gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens: Die Politik, der Präsident, die Kirche und die treuen Veteranen - sie alle stehen zusammen. Ja, Kroatien ist dank unserer Hilfe auf dem richtigen Weg.«
Er blieb neben Mirko stehen und beugte sich zu ihm herab: »Aber nun ist Stjepan Novak, Freund und tapferer Kämpfer für unsere Sache, tot. Vor dem verbrecherischen Tribunal in Den Haag, das vorgibt, wegen angeblicher Gräueltaten in Bosnien über uns richten zu können, hat er Gift genommen. Sein Märtyrertod wendete das Blatt endgültig zu unseren Gunsten. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Jede unüberlegte Tat könnte unübersehbare Folgen haben und unsere Glaubwürdigkeit gefährden.«
Er sah Mirko an: »Dennoch muss ich dich noch einmal um etwas bitten. Nach dem Tod Novaks soll jetzt sein Stellvertreter, unser persönlicher Freund General Milan Pzov, vor das Tribunal in Den Haag gezerrt werden.«
»Hat er denn etwas zu befürchten?«, fragte Mirko.
»Du weißt, dass es Zeugen gibt. Mitwisser, die bisher geschwiegen haben, weil sie mit Novak wenig zu tun hatten, dafür aber mit Pzov. Und die dabei waren, als er seinerzeit in Mostar für Ordnung gesorgt hat.«
Der General sah erneut auf das Gemälde, bevor er fortfuhr: »Den wichtigsten Zeugen hatten wir bereits im Visier. Aber Pzov will sichergehen. Das Tribunal hat in seinem Sinn entschieden. Deswegen musst du einen weiteren Auftrag übernehmen.«
»Damit bringe ich die Organisation unnötig in Gefahr,« wandte Mirko ein.
Der »General« sah ihn scharf an: »Du hast doch keine Skrupel deswegen?«
Mirko lachte: »Keine Sorge. Alles wird professionell ablaufen.«
An der Tür rief ihn der General zurück: »Es muss schnell gehen. Und denk an das Geld. Pzov hat viel zu lange darauf gewartet. Jetzt will er es zurückhaben.«
Erst, nachdem Mirko das Gebäude verlassen hatte, wurde ihm bewusst, dass er schwitzte. Er öffnete die Knöpfe seines Jacketts und sah sich um. Vorsichtig nahm er die Pistole aus dem Hosengürtel und übergab sie einem jungen Mann, der halb verborgen unter einer Arkade gewartet hatte. »In diesem Land kann man niemandem mehr trauen«, dachte er. Kurz darauf stieg er in ein Taxi, das ihn zum internationalen Flughafen von Zagreb brachte.
.
2
Gegen eins machten sie sich auf den Weg zu Fatima Kovac, der Witwe des Opfers. Philipp saß schweigend am Steuer. Was hätte er Azra, die neben ihm saß und die ganze Zeit aus dem Fenster sah, sagen sollen? Dass es ihm leidtat, dass er nicht zur Besprechung gekommen war? Oder vielleicht sogar, dass ihn die Erinnerung an seinen Bruder manchmal so mitnahm, dass er überhaupt nicht in der Lage war, mit irgendjemandem zu kommunizieren? Eigentlich wäre das nur fair. Er mochte Azra und ihre offene, ungezwungene Art. Und er arbeitete gern mit ihr zusammen. Sie mit ihm wahrscheinlich nicht mehr. Denn er hatte sie nicht zum ersten Mal hängen gelassen.
»Weißt du, wie wir von den Kollegen genannt werden?«, fragte sie unvermittelt.
Erstaunt sah er sie an. »Nein.«
»Die Kanaken-Truppe«, sagte sie. «Das hat mir Manke neulich im Bierhaus Machold gesteckt. Da war er schon blau. Außerdem meinte er, ich sollte ein bisschen zugänglicher sein. Schließlich seien wir im Rheinland.«
»Und du hast ihm keine runtergehauen? Oder es Rodenstock gesagt?«
»Lohnt sich nicht«, schnaubte sie verächtlich. »Außerdem hat er mir erklärt, dass das keine Beleidigung sein soll.«
»Und das glaubst du?«
»Vielleicht kommt seine Ablehnung daher, dass er glaubt, er hätte die Beförderung verdient gehabt«, meinte Azra. »Stattdessen wird die Truppe jetzt von einer halben Türkin und einem halben Griechen angeführt.«
»Das ›halb‹ kannst du weglassen. Das macht für ihn keinen Unterschied.«
Das silbergraue Saab 9-3-Cabrio kämpfte sich durch die ewige Baustelle im Godesberger Tunnel. Kurz vor der Eisenbahnbrücke bogen sie von der B9 rechts in die Mallwitzstraße ab. Der Ortsteil Pennenfeld im Bonner Süden war eine wenig attraktive Mischung aus Gewerbe- und Wohngebiet. Hier hatten sich die großen Supermärkte und Discounter angesiedelt, die den kleinen Läden in den angrenzenden Ortsteilen das Leben schwermachten. Während es im benachbarten Lannesdorf noch einen lebendigen Ortskern gab, wo man alles kaufen konnte, was man für den täglichen Bedarf brauchte, hatten in dem angrenzenden Dörfchen Muffendorf nur die Friseure überlebt.
Hinter dem Sportpark Pennenfeld bogen Philipp und Azra in die Paracelsusstraße ein. Es goss in Strömen, und die Scheibenwischer liefen im Schnellgang. Philipp parkte den Saab vor einer Reihe vierstöckiger Mehrfamilienhäuser mit langen Garagenfronten daneben. »Bevor wir mit Kovacs Witwe sprechen: Hast du was Neues?«
Sie schüttelte den Kopf: »Du hättest heute Morgen Rodenstocks Blick sehen sollen, als ich anfing zu reden. Er denkt wahrscheinlich, eine Frau sei nicht in der Lage, einen komplexeren Sachverhalt darzustellen. Immerhin habe ich ihm das Gegenteil bewiesen.« Sie sah ihn an: »War trotzdem scheiße, dass du nicht da warst.«
Philipp sah sie an, sagte aber nichts.
»Warum hat Kovac eigentlich einen bosnischen Pass? Wie lange lebte er schon hier?«, fragte er stattdessen.
»1993 ist er während des Bosnienkrieges nach Deutschland geflüchtet. Nach dem Krieg ist er als Härtefall anerkannt worden. Seitdem hat er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis.«
Philipp nickte. »Haben wir denn irgendwelche Hinweise auf den Mörder?«, fragte er.
»Nein, wir haben weder Spuren an Kovacs Kleidung gefunden noch auf dem Boden. Möglicherweise hat sich der Täter hinter einem Gebüsch versteckt.«
»Kovacs‹ Portemonnaie war leer. Es könnte ein Raubmord gewesen sein.«
»Möglich. Aber ich glaube nicht daran.«
»Hatte er ein Handy bei sich?«, fragte Philipp.
»Nein. Zumindest haben wir keins gefunden.«
»Was ist mit der Tatwaffe?«
»Unser Medizinguru Cornelius Meezen sagt, es handele sich um ein kompaktes Jagdmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge. Der Stich habe genau ins Herz getroffen. Kovac muss unmittelbar verblutet sein.«
»Der Mörder wusste, wohin er stechen musste«, sagte Philipp. »Bei einem Überraschungsangriff ist es gar nicht so leicht, das Messer so anzusetzen, dass der Stich genau an der richtigen Stelle sitzt.«