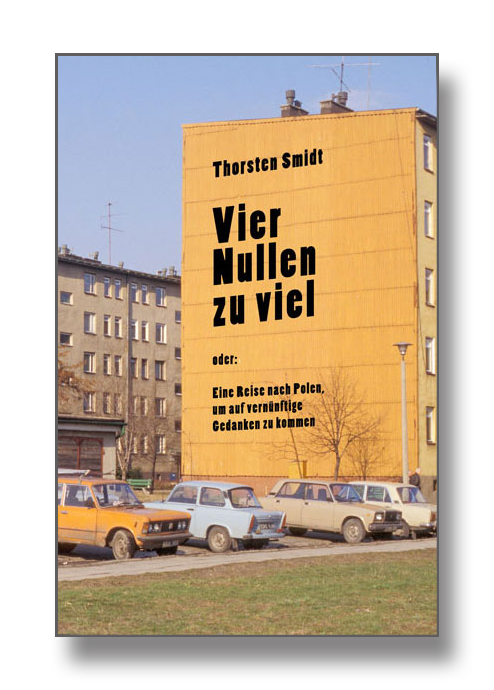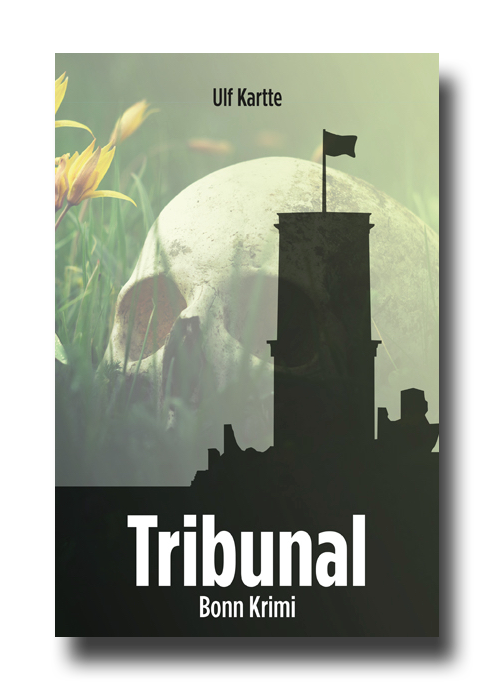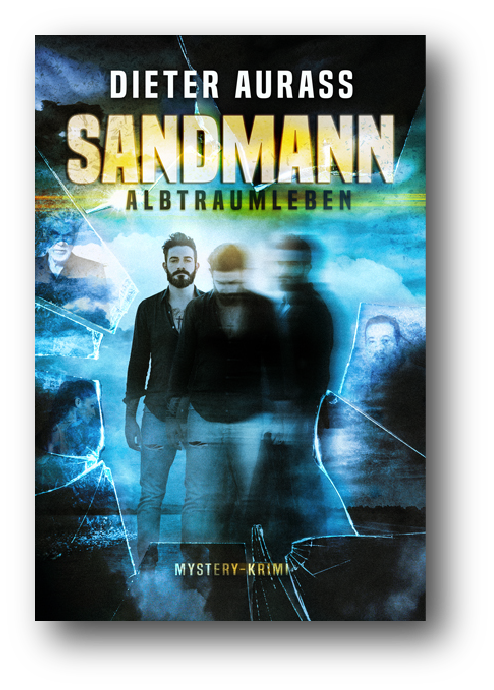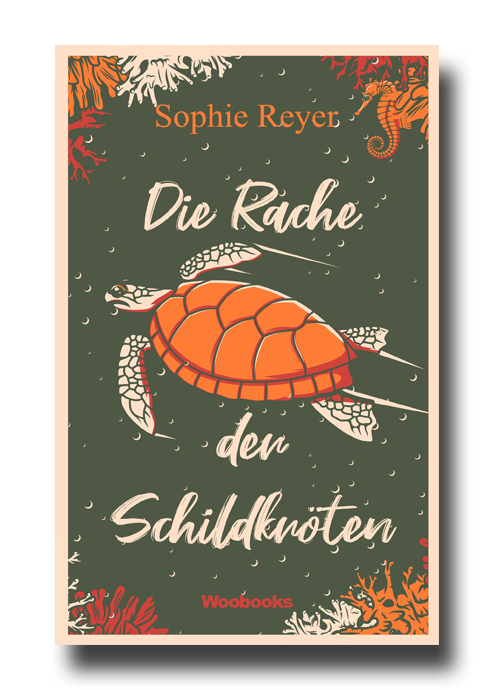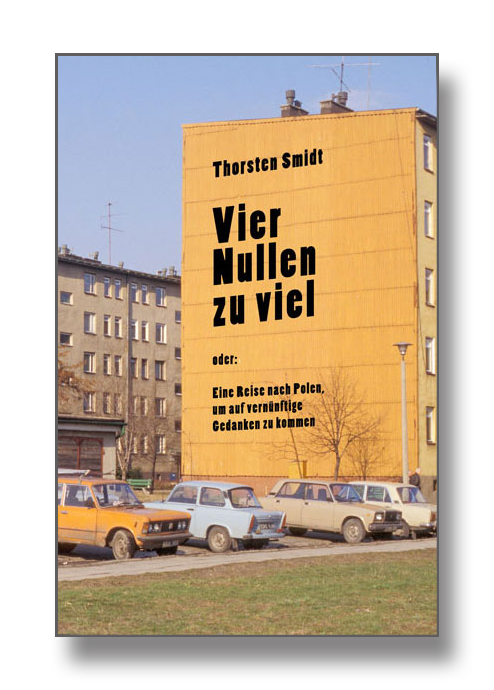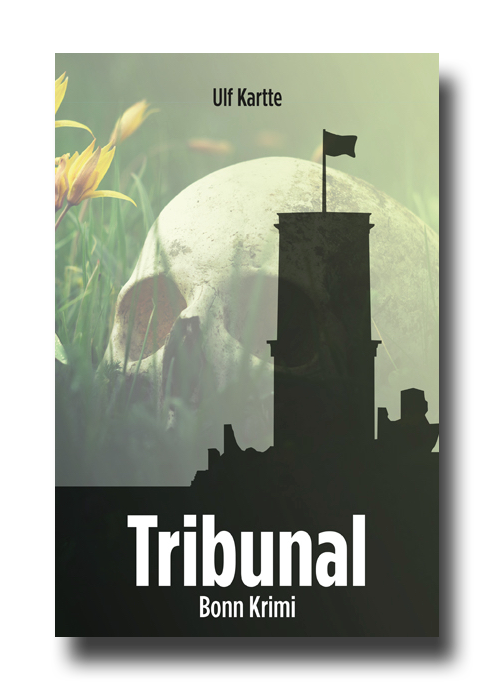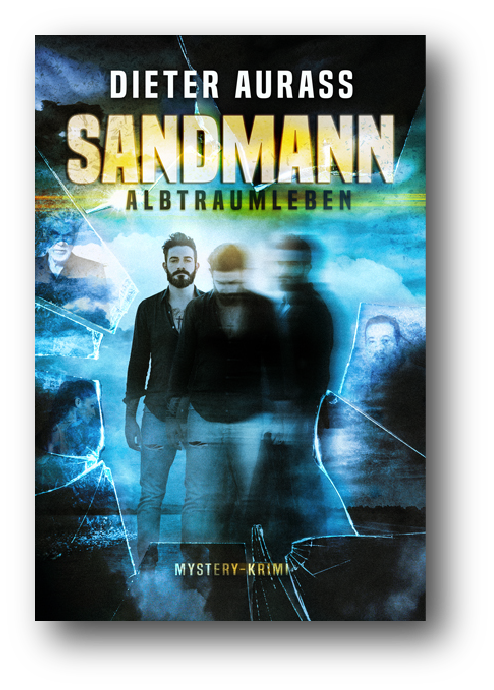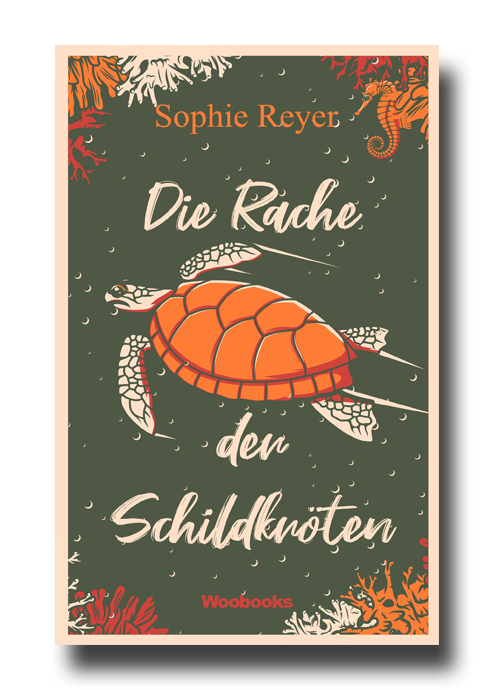Kapitel 1
aus: In Zebra-Schuhen – von Jasmin Meranius
Wenn es sich erst halbiert, um sich dann zu verdoppeln
Es war einmal eine junge Frau, die hasste Türgriffe. Sie hatte Angst, sich an ihnen anzustecken. So würde meine Geschichte wohl anfangen. Glaube ich zumindest. In einem Märchen hätte ich die Drehtür ins Gebäude vielleicht nur mit Hilfe einer guten Fee überwinden können. Und vielleicht hätte ich es ohne ihre Zauberkraft nicht einmal überlebt. Das wäre dann das frühe Ende meiner Geschichte.
Ist es aber nicht, denke ich und lächele zaghaft in mich hinein. Meine Geschichte, Johannes zurückzugewinnen, fängt gerade erst an. Genau hier, in dieser großen, fremden Stadt.
Guter Dinge, wenn auch ein wenig aufgekratzt, streiche ich im Foyer eines von Gründerzeit und Äppelwoi geprägten Gebäudes meinen Mantel glatt. Das Abenteuer Imagewechsel-für-den-Ex hat begonnen, und ich spüre, wie Adrenalin meine Adern durchflutet und mich von Sekunde zu Sekunde berauschter fühlen lässt. Ich glaube, ich bin noch nie lebendiger gewesen in einer Zeit schwermütigen Liebeskummers.
»Geht es dir gut?«, ertönt eine Stimme. Sie gehört zu einem Kerl, kaum älter als ich selbst, der mich offenbar bei meinem emotionalen Moment beobachtet hat, und tritt ungläubig hinter seinem Empfang hervor. Er überragt mich um einen ganzen Kopf. Ich betrachte den attraktiven Großstädter mit einem Haarschnitt, der aussieht, als sei er keiner, nun etwas genauer. Besser gesagt: sein weißes Hemd. Es lugt knitterig unter dem schwarzen Jackett hervor, und das auf eine Weise, dass ich mich frage, ob es gewollt ist oder ein Versehen.
»Klar geht es mir gut, wieso auch nicht?«, antworte ich, sobald ich dazu im Stande bin, sehe ihm ins Gesicht und neige schnell wieder den Blick. Ein herzförmiges Gesicht mit braunen Augen und zwei Grübchen neben dem Mund, der eindeutig ein spöttisches Lachen unterdrückt, sagt mein fotografisches Gedächtnis. Ja, der Kerl sieht zweifelsfrei gut aus, bedeutend attraktiver, als mir gerade lieb ist, sage ich.
»Na dann«, sagt er und schmunzelt. »Und ich dachte schon, es hätte heute Früh nicht nur mein Wecker kläglich versagt.«
Spielt er etwa auf meine Haare an?, frage ich mich empört und verlegen zugleich. Augenscheinlich selbstsicher klemme ich mir (vergebens) die wirren Locken hinters Ohr. Dabei funktioniert mein Wecker nebenbei bemerkt einwandfrei und selbst wenn er es nicht täte: Der hilft nicht bei Haarproblemen, sondern ein Glätteisen. So wie übrigens Bügeleisen. Genau das, sollte ich ihm sagen. »Alles bestens«, stammele ich und drehe mein Gesicht zur Seite. Ich gebe zu, dass die kleinen, gekräuselten Locken auf meinem Kopf ebenso gut an einer anderen Körperstelle hätten wachsen können. Und gerade das fanden alle irgendwann einmal niedlich.
Wieso hörte das bloß auf?
Da spüre ich, wie der Blick aus den großen freundlichen Augen meines Gegenübers belustigt an mir nach oben wandert, bis zu meinem Haar, als hätte er die Katastrophe erst jetzt bemerkt. Dann wandert besagter Blick sogleich wieder nach unten, zu meinen Füßen.
Sekunde mal – Füßen?
Ein Blitz durchfährt mich.
Heißkalt.
Verdammt!
Ich habe doch nicht etwa … Ich halte die Luft an und folge unauffällig seinen Blicken. Doch ich weiß es unlängst: Ich habe. Ich habe tatsächlich meine Zebrahausschuhe an – das erste Geschenk, das Johannes mir damals gemacht hat – und vergessen, sie vor dem Aussteigen gegen die neuen Pumps zu tauschen. Wie konnte mir das nur passieren? OK, ich wollte Blasen an den Versen vermeiden. Jeder weiß, wie furchtbar neue Schuhe sind, ausserdem ...
Das muss ein Alptraum sein, unterbreche ich meinen eigenen Gedanken!
Das ist ein Alptraum!
Der attraktive Städter zieht vergnügt die dunklen Augenbrauen hoch, als könne er meine Gedanken lesen und lacht ungeniert. »Und du bist wirklich sicher, dass alles in Ordnung ist? Es scheint mir eher, als …«
»Das ist das Ende!«, schneide ich ihm das Wort ab, mehr zu mir selbst gerichtet und schaue hektisch um mich, in der Hoffnung, den Seat meiner Mutter zu sehen, aus dem ich kurz zuvor ausgestiegen bin. Und in dem sich meine verdammten Pumps-Dings-Bums befinden. »Ich brauche sofort meine Schuhe!«
»Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich bin sicher, da gibt es eine gute Geschichte zu.«
»Gibt es nicht!«, stoße ich aufgeregt aus.
»Klar. Es gibt fast immer eine.«
»Vielleicht, ja, wahrscheinlich, doch sie ist nicht interessant genug.« So, wie alles an mir. Ich blicke hastig über die Schulter zurück in Richtung Ausgang.
»Eigentlich mag ich Geschichten, die erst auf den zweiten Blick ansprechen.«
Ich beschließe, darauf besser nicht weiter einzugehen.
»Du behältst deine Geschichten wohl lieber für dich, was?«
»Meistens ist das klüger, ja«, sage ich, ich kann mir nun mal nicht vorstellen, dass sich die Leute dafür interessieren, denke ich den Satz zu Ende.
»Also eine Geheimnishüterin, verstehe. Manchmal ist das vielleicht auch besser so.«
Ich schweige peinlich berührt, weil ich nicht weiß, ob es als Kompliment oder Beleidigung gedacht war. Wieder blicke ich hektisch zurück zur Drehtür. Als ich meine Mutter noch immer nicht entdecken kann, spult sich ein Katastrophenfilm vor meinem inneren Auge ab. Er zeigt, wie ich in meinen ausgelatschten Hausschuhen die neue Stelle in dieser fremden Stadt antreten muss und in Rekordschnelle Aufsehen erregen werde, indem ich mich zur Lachnummer der ganzen Werbeagentur mache. Was sage ich da: der ganzen Mainmetropole. Verzweifelt drehe ich mich wieder zu dem Knitterhemd vor mir um und würge mir ein tapferes Lächeln ab, das sagt: Hey, das mit den Zebras ist doch ulkig, gar nicht peinlich. Es gibt keinen Grund sich zu schämen. Vergebens suche ich die passende Stimme dazu und frage mich ernsthaft, ob der Moment überhaupt noch peinlicher werden kann. Da höre ich die flötende Stimme meiner Mutter hinter mir.
Und ja, er kann.
»Spätzchen, Susi, jetzt hast du schon wieder etwas vergessen. Und diesmal meine ich nicht den Friseurtermin.«
Eine Mischung aus Erleichterung und Scham überkommt mich. Ich beschließe, sie elegant wegzulachen. »Danke, Hanne«, presse ich hervor, nehme die Schuhe entgegen und schiebe meine Mutter bereits wieder durch die Drehtür nach draußen. Ja, ich nenne meine Mutter beim Vornamen, besser gesagt: bei ihrem Spitznamen. Hannelore mache sie alt, sagt sie immer, und streng genommen ist sie das ja auch. Während ich versuche, meinen Puls in Griff zu kriegen, zwänge ich mich mit hochrotem Kopf und - was die Sache nicht gerade einfacher macht - mit zwei Handschuh-Schichten in die Absatzschuhe hinein. Dabei bewege ich mich auf einem Bein hüpfend im Zickzack durch das Foyer, weg von dem Gebläse, als wollte ich den Keimen, die da rausgeblasen werden, manöverartig ausweichen.
»Sieht ganz so aus, als hättest du so einige uninteressante Geschichten über dich zu erzählen«, bemerkt mein Gegenüber mit einem gespielt sorgenvollen Blick und stützt mich am Unterarm, als ich einbeinig das Gleichgewicht verliere.
»Nein, wie schon gesagt, über mich gibt es nichts Interessantes zu erzählen.« Ob es genauso düster, depressiv rübergekommen ist, wie es sich anfühlt? Ich räuspere mich und versuche es noch einmal. »Zumindest nichts, das dich etwas angehen würde, verstanden?« Ruppiger als gewollt, reiße ich mich los, sobald ich endlich zwei Schuhe an den Füßen trage, die nicht zu hundert Prozent aus Teddyplüsch bestehen.
»Na schön. Verrätst du mir wenigstens deinen Namen?«
»Meinen Namen?« Verdattert runzele ich über die Hartnäckigkeit dieses merkwürdigen Schönlings die Stirn. Täusche ich mich, oder versucht er gerade trotz der peinlichen Nummer nett zu mir zu sein? Welch eine Ironie: Doch er ist nicht mein Typ. Er ist schließlich nicht Johannes. Dumpfer Herzschmerz keimt auf. »Nein, besser nicht«, sage ich, bemüht, nicht in meinem Elend zu ersaufen.
»Und wie soll ich dich dann nennen, wenn ich dich oben ankündige – Spätzchen oder Susi?«
Der Groschen ist gefallen.
Ich erröte, verärgert, dass dieser Kerl mir wahrhaftig noch immer gegenübersteht und das ganz plötzlich wie ein Schaulustiger am Unfallort, die Arme auf dem Rücken verschränkt, und dabei zusieht, wie meine Hallux valgus mit den engen Schuhen kämpfen. Und für eine Sekunde lang habe ich wahrhaftig angenommen, er würde mit mir flirten. »Für dich immer noch Susi«, brumme ich. »Nein, ich meine Susanna! Anna! Man nennt mich von nun an Anna. Bitte nicht Susi. Auf keinen Fall, Susi, hörst du …«, mit zusammengekniffenen Augen versuche ich seinen Namen auf dem Schild am Jackett zu lesen, »… verstanden, Adrian?«
»Ok. Aber ich heiße Arian. Und man nennt mich Arian.«
»Arian. Fein. Das macht auch keinen großen Unterschied.«
»Doch. Macht es.«
Ja ich weiß, denkt die Texterin in mir. Ziemlich genau einen Buchstaben. Ich richte mich innerlich auf und sage mit beinahe fester Stimme zu Arian, der scheinbar so etwas wie ein Concierge ist: »Also schön, Arian, ich beginne gleich meinen ersten Tag in der Wortfabrik, was schon schlimm genug ist, und wenn ich da jetzt nicht sofort raufgehe, beginne ich ihn auch noch verspätet.«
»Dann bist du die neue Senior-Texterin? Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Deine Vorgänger waren alle deutlich … redegewandter als du.«
»Ich bin ja auch Junior-Texterin. Ich meine, das bin ich mal gewesen. Jetzt bin ich … Praktikantin.«
Arian lächelt. »Alles noch mal auf Null setzen? Cool. Zweiter Stock. Und dann immer der Nase nach, Anna-und-nicht-Susi.«
Ich schiebe ärgerlich ertappt die Augenbrauen zusammen. »Tust du mir einen Gefallen? Kündige mich dort oben an als Anna! Bitte einfach Anna, okay?«
»Klar, Anna, wenn es sonst nichts ist. Aber irgendetwas sagt mir, dass es nicht bei diesem einen Gefallen bleiben wird.«
Ohne einen weiteren Kommentar steuere ich den Lift an. Ein wenig umständlich betätige ich mit dem Ellbogen den Knopf. Streng genommen ist er ein Pfeil, der nach oben zeigt und den ich beim besten Willen nicht mal mit meinen Handschuhen berühren will. Dabei bin ich so konzentriert auf das, was mich da oben erwarten wird, dass ich eine Weile brauche, ehe ich kapiere, dass jemand etwas durch das Foyer ruft. Dabei höre ich es deutlich. Nur gilt es irgendwie nicht mir - zumindest fühle ich mich nicht angesprochen - oder doch?
»Anna, ich sagte links!«
Sekunde mal, ich bin doch Anna – verflixt, zumindest wollte ich das sein. Mein Kopf fährt herum. Arian deutet mit ausgestrecktem Arm nach links. »Wenn du nicht in die Gynäkologie willst, musst du den linken Lift nehmen. Nicht den rechten.«
Tatsächlich. Es sind zwei Firmennamen und zwei Aufzüge, die in unterschiedliche Gebäudeteile führen. Ich setze mein reizendstes Lächeln auf. »Klar. Danke.«
»Viel Glück da oben in der Höhle der Löwen, also, für deine Zebras, meine ich. Ich glaube, sie werden es brauchen.«
Ehe ich mir über Arians Worte ernsthaft Gedanken machen oder einen Rückzieher machen kann, öffnet sich zum Glück die Lifttür. Als sie wieder hinter mir schließt, trete ich mit klopfendem Herzen an den Spiegel heran.
Zähnecheck? Jap. Ein Faupax pro Tag genügt.
Lederhandschuhe ausziehen? Check.
Die weißen dünnen Baumwollhandschuhe darunter übersehen – erledigt.
Nervös schnaubend öffne ich den Reißverschluss meines Wintermantels, um mir Abkühlung zu verschaffen. Mit zunehmender Aufregung beäuge ich meinen neuen dunkelblauen Zweiteiler darunter, der laut meiner Mutter zum grün meiner Augen passen soll, während ich mit dem Ellbogen auf den Knopf für die zweite Etage drücke. Normalerweise trage ich Jeans und leger sitzende Shirts in allen erdenklichen Erdfarben, dazu eine hellgraue Strickjacke und bequeme Sneaker. Zumindest würde ich das angeben, wenn ich meine eigene Vermisstenanzeige herausgeben müsste. Was ich natürlich nicht muss - vorausgesetzt, dieser Fahrstuhl wird regelmäßig gewartet.
Das wird er doch, oder etwa nicht?
Bevor sich gleich die Lifttür zu meinem neuen Leben öffnen wird, winde ich mich aus meinem Wintermantel, dann aus dem Blazer, schnüffele unauffällig in Richtung meiner rechten Achsel und ziehe es kopfschüttelnd direkt wieder an. Verunsichert streiche ich über den engen Bleistiftrock, dann über den dazu passenden Blazer, bevor ich schließlich ein wenig an meinem verkrumpelten weißen T-Shirt zupfe, denn es sieht auf einmal so aus, als gehöre es nicht dorthin. Dabei habe ich es in der Früh in meinen Rock geschoben, so, wie die Verkäuferin es mir erklärt hatte. Jetzt frage ich mich erschrocken, ob ich nicht viel mehr wie eine Politesse aussehe; nun auch noch obendrein wie eine mit verkrumpeltem T-Shirt.
Klasse, das kannst du nun vergessen, Susi. Das T-Shirt bleibt, wo es ist.
Mit dem Wintermantel unter dem Arm betrete ich wenige Sekunden darauf mit an den Körper gepressten Oberarmen mein neues Leben, und das auf zehn Zentimeter hohen Pumps - die nebenbei bemerkt ganz klar meine ersten und letzten sein werden. Kaum bin ich zwei Schritte gegangen, kralle ich prompt die Zehen darin an. Ich merke, wie ich verunsichert die Schultern hochziehe. Ein wenig verloren stehe ich nun da und warte artig ab. Als ich zu der Erkenntnis komme, dass mich dieser Arian offensichtlich nicht angemeldet hat und demnach keiner mehr kommen wird, um mich in Empfang zu nehmen, betrete ich kleinschrittig auf eigene Faust die Agentur. Das ist also die Frankfurter Werbeagentur, für die ich kurzentschlossen alles riskiert habe und die mir mein Leben zurückgeben soll, das Johannes heisst? Ich schaue um mich, betrachte das Großraumbüro im loftigen Fabrikhallenstil und seine Schreibtische, die nur durch halbhohe Glaswände getrennt sind, die mit bunten Post-it zugehängt sind. Bei all der offenen, kommunikativen Atmosphäre suche ich blickdichte Trennwände und Plätzchen, an denen man sich verkriechen kann. Und finde sie nicht. Dabei frage ich mich, was dieses Büro über die Menschen, die hier arbeiten, aussagt? Brauchen sie wirklich so viel Raum, um kreativ zu sein? Oder ist es nicht vielmehr ihr Ego, das ihn verlangt? Wie soll ich - mäßig kreativ, mit einem geringen Platzbedarf und gänzlich ohne Ego - diesen Raum nur füllen? Ich frage mich erneut, ob das Ganze hier eine gute Idee gewesen ist und ich nicht einfach wieder gehen sollte. Zu allem Übel sehe ich nur erschreckend schöne Menschen - stylisch hipp in auffälligen Klamotten, inspiriert von Ihresgleichen aus diversen Modemagazinen. Da erregt ein Mann meine Aufmerksamkeit: mit nach hinten gekämmtem Haar und dichtem Bart steht er nur wenige Meter von mir entfernt am Schreibtisch einer hübschen Blondine mit einem Tablett in der Hand und bringt ihr einen Kaffee. Diese scheint - ihrem verträumten Blick nach zu urteilen – vollkommen gefesselt von dem, was er sagt, die Kollegen um sich herum zu vergessen. Da wird mir bewusst, dass ich gerade von dem Kaffeeboten angesprochen werde, und versuche mich trotz Nervosität zusammenzureißen und zu antworten, sobald er zu Ende gesprochen hat - so, wie man es in einer erwachsenen Konversation nun mal macht.
»Die meisten wissen gar nicht, dass es eigentlich »Vulva« heisst und nicht »Scheide«, sagt er unvermittelt.
»Wie bitte?«, frage ich überfahren.
Da deutet er auf eine aprikosenartige Betonfigur, neben der ich stehe und hält mir eine Kaffeetasse hin, die ich mit einem zaghaften Kopfschütteln ablehne. Breitschultrig stellt er sich neben mich, den Blick geradeaus auf das Kunstding gerichtet, auf das er deutet, ehe er nun zu mir gewandt weiterspricht. »Pardon, deinen Blicken nach zu urteilen, scheine ich dich mit dieser Offenbarung in Verlegenheit gebracht zu haben.«
Als ich das Vergnügen bemerke, das ihm meine Unwissenheit - oder mein Erröten? - offenbar bereitet, schüttele ich andeutungsweise den Kopf. Und gehe instinktiv einen Schritt zurück. Mein Gesprächspartner schmunzelt. »Die Vulva soll eigentlich die frauenfreundliche Firmenphilosophie dieser Agentur unterstreichen und keine Frauen abschrecken«, erklärt er mit tiefer Stimme, die beruhigend wirkt. Jedoch nicht beruhigend genug, um die Schamesröte zu vertreiben, die sich gleich in Form von Stressflecken auf meinen Hals ausweiten wird, wenn er das Wort Vulva noch ein weiteres Mal ausspricht.
»Sie ist wirklich ganz toll … also, die frauenfreundliche Philosophie«, erkläre ich und finde, die Vulva sollte doch besser in der Gynäkologie ein Stockwerk tiefer hängen, und nicht in dieser Werbeagentur. Ich mustere den Mann, der noch immer auf die Vulva blickt, unauffällig von der Seite – sein halblanges, nach hinten gegeltes Haar, das grau meliert Ton in Ton in seinen Vollbart übergeht – und drehe mich rasch ebenfalls wieder zu der Vulva um, als er zu mir schaut.
»Ist alles in Ordnung?« Er lächelt sanft.
Wieso nur, werde ich das ständig gefragt? Ich nicke andeutungsweise und suche nach einer Ausflucht. »Alles bestens, sogar so gut, dass es besser gar nicht sein könnte.«
»Goldig. Ich scheine dich tatsächlich schockiert zu haben.« Er legt einen durchdringenden Blick auf, eine Hand in der Jeanstasche, und lächelt mich dann plötzlich an, sodass sich tiefe Lachfalten um seine Augen legen. Ziemlich tiefe sogar. »Und du möchtest ganz sicher keinen Kaffee? Ich meine, zur Beruhigung.«
»Nein, danke, wie gesagt, mir geht es blendend«, erkläre ich und vermisse schon jetzt mein altes Leben.
»Ich bin übrigens Pet.«
»Susanna Sonnenburg, die neue Praktikantin. Heute ist mein erster Tag.«
»Dann bist du meine Verstärkung? Wieso sagst du das nicht gleich?« Erst jetzt fallen mir seine stechend blauen Augen auf, die trotz der Furchen um sie herum fordernd wirken wie die eines Kindes und zu mir herüberstrahlen.
»Naja, ich habe eine ganze Weile darauf gewartet, dass das jemand bemerkt. Das mache ich eigentlich schon mein halbes Leben lang. Es scheinen jedoch alle … ziemlich viel um die Ohren zu haben«, erkläre ich.
»Vielleicht möchtest du mit mir vorliebnehmen? Als Mädchen für alles habe ich ein paar Sekunden Zeit. Komm, ich zeige dir deinen Schreibtisch, Susanna.«
Auch ein Praktikant also? Und das in diesem Alter?, denke ich und sage erleichtert: »Vielen Dank. Auch, dass ich hier nicht die einzige unterbezahlte Stelle mit miserablen Arbeitszeiten und wenig Aussicht auf eine Festanstellung sein werde.« Ich hätte ja noch vor zwei Minuten nicht glauben können, das so schnell sagen zu können, aber Pet und ich haben etwas gemeinsam. Am Schreibtisch angekommen, stelle ich darauf meine Tasche ab und sage: »Cool, netter Schreibtisch.«
Pet lacht daraufhin kurz laut auf, als würde ich scherzen, was ich nicht tue, dennoch erwidere ich sein Lachen und breche ein wenig überdreht in Gelächter aus.
»Schön, dass er dir gefällt, Susanna. An ihm wirst du in den nächsten Wochen viel Zeit verbringen. Du hast sicher von dem Parfümhaus-Mayer-Pitch gehört, der bevorsteht. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen, wenn wir unseren besten Kunden halten wollen. Doch wenn ich dich so betrachte …« – sein Blick scannt jeden Zentimeter meines Körpers ab – »bist du da auch nicht der Typ für.«
Ich folge seinen Blicken und schaue an mir herunter. »Wieso? Stimmt etwas nicht?«, frage ich, erschrocken, es tatsächlich laut getan zu haben.
»Ich nehme an, deine Überpünktlichkeit und der feine Fummel, in den du dich geworfen hast, sind kein Zufall.«
Fummel? Ich ziehe verlegen mein T-Shirt ein Stück weiter aus dem Rock heraus, zum Beweis, dass es krumpelig ist, und betrachte die löchrigen Jeans meines Gegenüber und das mehr als hippe bordeauxfarbene Longsleeve-Oberteil darüber, das aussieht, als sei es schon x-mal gewaschen worden, obgleich es das sicher nicht ist. »Ich wollte doch nur einen motivierten Eindruck machen«, erkläre ich ein wenig kleinlaut.
Der Praktikant zwinkert mir zweideutig zu. »Ich verstehe schon. Alle Praktikanten wollen den Geschäftsführer beeindrucken.«
»Nein, nur meinen … neuen Vermieter«, flunkere ich ertappt und erspare mir auszuführen, dass dieser im tätowierten Körper einer jungen Frau steckt, die noch nicht ganz in meinem Alter sein dürfte und sich mit zwielichtigen Internet-Bloggs als selbsternannte Influencerin oder Online-Kolumnistin etwas dazuverdient.
Stattdessen füge ich hinzu: »Mein Vermieter ist sehr zugeknöpft, da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Man kennt doch den Wohnungsmarkt in Frankfurt und was man ihm so nachsagt.« Ich will gerade zum Beweis auf meinen Koffer voller Klamotten deuten, den ich später noch in mein neues WG-Zimmer bringen werde, und stelle dabei fest, dass er gar nicht da ist. »Verdammt, ich glaube, ich habe meinen Koffer unten im Wagen vergessen. Ich sollte ihn besser holen.« Und mich umziehen, und zwar sofort!, schreie ich innerlich.
Fluchtartig lege ich den Rückwärtsgang ein. Diesmal nehme ich die Treppe, - ein Unglück kommt selten allein. Ich würde gerne behaupten, dass Anna sich wegen der gefloppten Klamottenwahl gut geschlagen hat, und nicht wie Susi knallrot geworden ist - doch das hat sie nicht, wie mir meine prickelnden Wangen verraten.
Wenig später verlasse ich kurzatmig, mit meinen Schuhen in der Hand und großen Schritten (so groß es der enge Bleistiftrock zulässt) das Foyer, tripple auf Nylons zur Drehtür und sehe durch sie nach draußen, um festzustellen, dass meine Mutter weg ist.
»Dein Koffer steht hier, bei mir, hinter der Anmeldung«, ruft Arian, der Concierge, und schaut mich vergnügt mit seinen freundlichen Augen an.
»Mein Koffer? Aber woher hast du denn gewusst …«, stammele ich verdattert und heilfroh zugleich, als ich meinen Koffer erblicke. Arian, dessen Lippen sich zu einem breiten Grinsen verziehen, antwortet: »Deine Mutter hat mich so nett gebeten, den Koffer für dich aufzubewahren, da habe ich eine Ausnahme gemacht. Also, für deine Mutter, nicht für dich. Brauchst dich also nicht zu bedanken.«
Ich beschließe, seine Bemerkung zu überhören, laufe zu meinem Koffer, gehe in die Hocke und öffne ihn. Und beginne darin zu wühlen. Wieso hilft mir nur keiner und sagt mir, was ich anziehen soll? »Du kennst dich nicht zufällig mit Mode aus?«, frage ich in meiner Verzweiflung. Mein Blick fällt auf sein Knitterhemd und die zu kurzen Ärmel am Jackett. »Vergiss, was ich gesagt habe.« Ernüchtert schließe ich den Koffer wieder. Denn besser wird es nicht auf die Schnelle. Da muss ich jetzt durch. Ich werde einfach eisern bei meiner Story mit dem Vermieter bleiben.
»Womit sonst kann ich zur Verfügung stehen?« Arian verbeugt sich bühnenreif mit einer großen Geste. Ich ignoriere sie, bedanke mich knapp und ziehe meinen Koffer zum Lift. Wieder in der Agentur angekommen, schleiche ich mit ihm und in meinem blauen Zweiteiler über den Gang und versuche mir dabei wieder und wieder Johannes’ Stimme vorzustellen, wie er sagt, dass er mich noch immer liebt und ich kein bisschen bieder aussehe. Dabei klammere ich mich an meinen Koffer und fühle mich an meinen ersten Arbeitstag damals erinnert.
»Hi«, sage ich mutig zum ersten Großstadtschönling, der mir über den Weg läuft. »Wo finde ich denn den Geschäftsführer?«
Ohne mir große Aufmerksamkeit zu schenken, deutet er wortlos auf einen Glaskasten, der in der Mitte des Großraumbüros steht, wie eine Raucherinsel an einem Bahnhof, und von dem sternförmig die Schreibtische der Mitarbeiter abgehen. Und in dem sich nur der Praktikant, Pet, beim Putzen eines Whiteboards verdingt. Ich klopfe an die offen stehende Glastür und lächele Pet an, der gerade mit einem Schwamm eine Gedankenwolke wegwischt. Er dreht den Kopf zu mir und erwidert mein Lächeln überschwänglich.
»Hey, da bist du ja wieder«, sagt er. »Hast du alles erledigen können?«
»Mehr oder weniger«, sage ich.
Eine Kollegin - besser gesagt ein Heidi-Klum-Klon - steckt den Kopf zur Tür herein und sagt: »GF, wir brauchen dich dringend für einen Schulterblick im Konfi. Und zwar bevor Blut fließt.«
»Zwei Minuten. Biete den Streithähnen zur Überbrückung einfach einen Boxhandschuh an, bis ich da bin. Danach ein Pflaster«, antwortet Pet entspannt und lehnt sich mit gekreuzten Beinen an den Schreibtisch.
»GF?«, stammele ich leise und sehe dem Klon nach, wie er beinahe rennend den Glaskasten verlässt, als wollte er sicherheitshalber nicht nur ein Pflaster, sondern gleich einen ganzen Verbandskasten holen. Dann sehe ich Pets belustigten Blick und spüre, wie meine Wangen zu prickeln beginnen.
»Sagte ich nicht, dass ich Pet bin? Wie Peter Schmitthammer?«, fragt er belustigt.
»Peter Schmitthammer? Der Name, der draußen an der Tür steht? Du bist nicht der Geschäftsführer?« Mein Herz beginnt zu klopfen. Auf eine Art, wie es nun mal klopft, wenn man seinen neuen Chef beleidigt hat. Oder sich vor ihm bis auf die Knochen blamiert hat. Und das gleich mehrfach. »Entschuldigen Sie, ich dachte wohl …«
»Dass ich der Praktikant bin?«
»Es tut mir wirklich sehr leid.«
»Und mir tut leid, dass ich dich vielleicht ein kleines bisschen in dem Glauben gelassen habe. Ich finde es immer mal wieder ganz schön, nicht der Boss zu sein, weswegen ich solche Situationen gerne ausnutze.«
»Und ich nutze jede Gelegenheit, um sie zu einer peinlichen Sache werden zu lassen. Ich habe mich total daneben benommen.«
Mein neuer Chef schmunzelt, fährt sich über den gepflegten Bart, stützt sodann die Arme auf der Schreibtischplatte ab und mustert mich von meinen Absätzen an aufwärts, als wolle er sich jedes kleine Detail einprägen, ehe er mich hochkant rausschmeißt. Auf Höhe meiner grünen Augen hält er inne. »Susanna Sonnenburg aus Sommerkahl ist eine wirklich bezaubernde Alliteration. Wusstest du, dass auch ich ursprünglich aus der Ecke stamme?«
Nein, denke ich, und hänge gedanklich noch an einer anderen Stelle fest. Ich meine, mal im Ernst: Bezaubernd? Ich? Während ich das viele Blut, welches ich meinem immer schneller werdenden Herzschlag zu verdanken habe, bereits in meinen Ohren rauschen höre, spüre ich seine eindringlichen Blicke auf mir. Alles schreit in mir auf. Anstatt etwas zu entgegnen, das die Situation entschärft, starre ich Pet Schmitthammer an. Ich betrachte diesen Mann mittleren Alters, der mich auf eine Art ansieht, wie ich Zeit meines Lebens noch nie angesehen wurde. Womöglich liegt das daran, dass ich ihn anglotze, so, als wäre er der erste Mann um die fünfzig, den ich in meinem Leben sehe. Schliesslich ist der attraktive, breitschultrige Praktikant jetzt mein Boss - und ich? Ich bin seine bezaubernde Alliteration. Was auch immer das bedeuten mag.
Doch eins nach dem anderen.
Antworte endlich, Susi!, schreie ich innerlich, nun sag´ schon was und steh nicht da wie ein Frischling, dem es die Sprache verschlagen hat. Du bist schließlich Texterin! »Habe ich schon gesagt, wie dankbar ich bin, hier zu sein, Herr Schmitthammer?«, quetsche ich durch die Zähne.
»Siehst du, Susanna, kaum wissen sie wer ich bin, schon sind sie nicht mehr sie selbst«, sagt er schulterzuckend. »Ich hoffe, mein großer Bruder hat nicht noch dazu beigetragen und dich eingeschüchtert?«
Bruder?, denke ich verwirrt und habe keinen Schimmer, wovon er da gerade spricht.
»Aber was sage ich da«, fährt Pet Schmitthammer mit verändertem Tonfall fort, »natürlich hat er. Schließlich überlässt der Saubermann nichts dem Zufall. Besonders nicht, wenn es um seine kleine geliebte Firma geht. Und seine Mitarbeiter. Habe ich recht?«
»Nein«, winke ich kopfschüttelnd ab. »Keine Einschüchterung, Herr Schmitthammer.«
»Na, das ist aber eine Überraschung. Genauso überrascht war ich, dass er dich gehen lassen hat, wo doch unser Verhältnis in den letzten Jahren … sagen wir, bedauerlicherweise nicht gerade das Beste war.«
Nicht das Beste?, wiederhole ich im Geiste, als es Klick macht. Es muss sogar mehr als nur das gewesen sein, wenn mein Chefchen einen Bruder in Frankfurt nicht mal erwähnt hat. Gedankennotiz eins: Nachforschung anstellen, wie die beiden ungleichen Puzzelstücke zusammenpassen. Gedankennotiz zwei: Bloß nicht! Völlig irrelevant. Ich bin wegen etwas ganz anderem hier - um meine Angelegenheiten zu klären und nicht die meines alten Chefs -, und dabei kann mir auch mein neuer Chef nicht helfen.
Oder doch?
Da passiert es: Pet Schmitthammer erhebt sich von der Tischkante, macht einen Schritt auf mich zu, sieht mich dabei aus nächster Nähe ein paar Sekunden länger an, als gut für mich ist, und hält mir die Hand hin.
Einen Moment lang zögere ich.
Erwähnte ich schon, dass mir an schlechten Tagen nicht nur Türgriffe oder Knöpfe in Aufzügen Sorgen bereiten, sondern auch Hände?
Noch immer starre ich auf Pet Schmitthammers Hand.
Dann auf meine behandschuhte.
Sicher denkt Pet, ich trage sie, weil ich Probleme habe. Doch da liegt er eindeutig falsch. Die anderen Leute haben Probleme mit meinen Handschuhen. So wie auch Johannes. Die Absurdität meiner Gedanken, die aufkeimen, ist mir bewusst. Doch ich bin nun mal nicht grundlos vier Monate, drei Wochen und fünf Tage lang krankgeschrieben gewesen. Die Frage eines Psychologen nach dem auslösenden Moment, der für meinen desaströsen emotionalen Zustand verantwortlich gewesen ist, ließe sich schnell beantworten: Johannes hat Schluss gemacht. Und zwar aus heiterem Himmel. Keine Ahnung, wie lange man für gewöhnlich braucht, um eine Trennung zu verdauen. Ich, Susi Sonnenburg, habe jedenfalls ziemlich lange gebraucht.
Und brauche noch immer, wie man sehen kann.
Ja, ich habe Liebeskummer, seit genau vier Monaten, drei Wochen und fünf Tagen. Doch wer zählt schon die Zeit, die seit dem verteufelten Tag vergangen ist? Oder die Schokoladenpapierchen (588), die sich seitdem in meinem alten Kinderzimmer im Haus meiner Eltern angesammelt haben, in das ich kurzerhand mit achtundzwanzigdreiviertel wieder zurückgezogen bin?
Ich denke fest an meinen Ex, bis sich das vertraute, wohlige Gefühl in meinem Oberbauch einstellt, und streife in Zeitlupe den Handschuh ab, Finger für Finger. Und ergreife die warme gepflegte Hand meines Gegenübers. Als sich unsere Hände berühren, stelle ich überrascht fest: Ich lebe!
Selbst, als er sachte zudrückt: nichts. Keine merkwürdigen Gedanken in meinem Kopf, kein sofortiges Krepieren, - nur wieso nicht?
»Herr Schmitthammer«, sage ich feierlich, während ich seine Hand nun kräftig schüttele, »nennen Sie mich bitte während der nächsten Wochen Anna. Susanna klingt viel zu … gewöhnlich, finden Sie nicht auch? Und eine Junior-Texterin wie ich, sollte alles andere sein als das.«
»Ich verstehe«, nickt Pet Schmitthammer. »Mir scheint, da will wohl jemand etwas abschütteln.«
Ich will so einiges abschütteln, zum Beispiel diesen grauen Kittel, den ich Zeit meines Lebens trage, denke ich und frage: »Abschütteln?«
»Na, den Juniortitel.« Pet Schmitthammer lächelt prüfend – vielleicht ist es auch ein Auslachen –, und das noch immer ohne meine Hand loszulassen. Was mir phänomenalerweise noch immer nicht den Boden unter den Füßen wegzieht.
»Erwischt«, improvisiere ich und finde die Idee gar nicht schlecht. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? »War das denn so offensichtlich? Ich meine, abwegig?«
»Ja. Und nein. Sagen wir, ich habe für solche Dinge einen sechsten Sinn. Und der ist entzückt.«
Entzückt? Wieso auch nicht? Ich zeige Johannes nicht nur, was meine neue Unterwäsche nach diesem Praktikum in der Großstadt draufhat, sondern, was ich draufhabe. Ja, ich mache ganz vielleicht doch noch Karriere. So, wie Johannes. Hier, in dieser Agentur verliere ich meine berufliche Jungfräulichkeit: Meinen Juniortitel.
»Ist das wirklich Ihr Ernst, Herr Schmitthammer? Es hieß, die Stelle sei befristet.«
»Ich weiß, man sagt mir nach, dass ich nicht unbedingt besonders zuversichtlich wirke, wenn es um eine Stellenvergabe geht, aber das hier ist mein zuversichtliches Gesicht. Bleib einfach dicht an mir dran, Susanna. Dann wird das schon werden. Womöglich auch über deine Befristung hinaus.«
»Im Ernst? Das wäre wundervoll. Ich stehe bereit, und das so dicht, wie Sie wollen«, sage ich, was ich auch werde, schließlich bin ich sonst nach den drei Monaten arbeitslos und noch unattraktiver für Johannes, als ich es jetzt schon bin. Ich strecke den Rücken durch, als erwarte ich jeden Augenblick eine Ehrenmedaille umgelegt zu bekommen - was sich nach der überaus ritterlichen Händeschüttel-Nummer auch ein klitzekleines bisschen so anfühlt. Pet Schmitthammers Miene erwächst währenddessen zu einem Lachen. Ich versuche nicht zu genau hinzusehen. Wenn ich es doch würde, müsste ich nämlich erröten und annehmen, dass er flirtet. Die Intensität seiner Blicke könnte darauf schließen lassen. Dabei könnte ich seine Tochter sein. Na gut, nicht ganz, aber die Tochter seines älteren Bruders und somit seine Nichte. Ist das zu glauben, etwa paranoid?, frage ich mich und falle in sein ansteckendes Lachen mit ein. Ja, vielleicht etwas zu überdreht, aber ich mache es. Denn ich spüre, dass etwas in Gang kommt. Das erste Mal seit Monaten. Johannes wird gar nicht anders können, als mich nach dieser bleib-einfach-dicht-an-mir—dran-Nummer zu mir zurück zu wollen. Er wird sehen, durch welche … großartige Schule ich gegangen bin. Würden meine neuen Dessous nicht gerade schrecklich kneifen, könnte ich glatt meinen, ich träume.
***
Meinen ersten Tag in der neuen Agentur habe ich wie durch einen Schleier erlebt. Er lichtet sich erst, als ich vor dem Hauseingang des neugebauten, weißen Hauses nur wenige Straßen von der Agentur entfernt, in der Dunkelheit in meiner Handtasche krame. So viel weiß ich schon mal: Die Wohnung, die für die nächste Zeit so etwas wie mein Zuhause sein soll, befindet sich im Trendviertel Sachsenhausen und direkt neben einer stillgelegten Fabrik, die als Veranstaltungsstätte herhält und am Fuße des Lerchesbergs liegt. Auch, dass alles neuwertig und sauber ist, beruhige ich mich und meine Keimfobie selbst, während über mir wie an einer Perlenschnur aufgefädelt ein Flieger nach dem anderen startet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich mich jemals an ein Leben hier - ohne Jo - gewöhnen würde.
»Hey, du bist doch meine neue Untermieterin, nicht wahr?«, höre ich eine piepsige weibliche Stimme neben mir. Sie gehört zu einem zierlichen Persönchen mit beängstigend wachem Blick für die späte Uhrzeit, platinweiß gefärbtem Haar, das beinahe in der Dunkelheit leuchtet, ebenso wie ihre knallig geschminkten, vollen Lippen, die ich auf Anhieb als das Schönste in ihrem Gesicht erkläre. Mit leichten Schatten unter den etwas hervorstehenden, großen Augen, schiebt sie sich aufgedreht an mir vorbei, fummelt ihren Schlüssel ins Schloß und blockiert mit ihrer riesigen Designerhandtasche die Tür.
»Ja, das bin ich«, nicke ich schüchtern, greife meinen Koffer und presse die blaue Ikeatüte, in der mein Bettzeug ist, fester an meinen Körper.
»Nette Ikeatüte. Ich bin Ina.«
»Susanna, aber nenn mich bitte Anna. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also, dass mit der Plastiktüte.«
»Verstehe. Ich bin übrigens deine Vermieterin.«
»Ich weiß, wir haben uns neulich bei der Wohnungsbesichtigung schon mal getroffen.«
»Wirklich?«
Ich suche für zwei Sekunden nach den passenden Worten, um dem Moment nicht noch mehr Peinlichkeit beimessen zu müssen, als er sowieso schon inne hat. »Ja und danke, dass das mit dem Zimmer so kurzfristig geklappt hat, Ina.«
»Kein Ding.« Sie geht in ihren Overknees und ihrem kurzen Rock in einer eleganten Bewegung in die Hocke, dass beinahe ihre Pobacken hervorgucken, schnappt sich meinen Koffer und bedeutet mir ihr zu folgen. Dann schwankt sie mit dem guten Stück auf ihren dünnen Absätzen durch das Treppenhaus, als würde das Gewicht des Koffers sie jeden Augenblick umwerfen.
»Soll ich den Koffer vielleicht besser nehmen?«, frage ich, besorgt, sie könne umknicken und sich auf den dünnen Absätzen sonst was brechen.
»Keine Sorge, meine Jimmy Choos können das ab. Es war wohl einfach ein winziges Gläschen zu wenig.«
»Jimmy wer?«, frage ich. »Nicht, dass mich das etwas angehen würde«, setze ich hastig hinzu.
»Folgst du etwa nicht meinem YouTube-Channel? Das solltest du aber, wenn du in dieser Stadt überleben willst. Und jetzt will ich einfach nur einen Joint rauchen. Ich zeige dir schnell dein Zimmer. Du kannst mir auch morgen noch von deinen Abgründen erzählen, die dich in meine Wohnung geführt haben. Die Miete für die Woche kannst du mir auch gleich hinlegen.«
Ich sehe meine neue Vermieterin und Mitbewohnerin an - ebenso ihre Tattoos, die hier und da vorwitzig herausragen -, um festzustellen, ob das mit dem Joint ein Witz sein sollte, und zu dem Entschluss zu kommen, dass sie es ernst meint. Denn sie und das lange dicke Zigarettending, das sie aus ihrer Jacke zaubert, und die sie auf den Boden fallen lässt, verschwinden ohne Umwege in ihr Zimmer. Mit ihnen ihre vielen Totenköpfe, Feen und Drollfrauen, die sich auf der blassen Haut gerade gezeigt haben, und die mich offen gestanden ein wenig einschüchtern. Ich lasse meinen Koffer und meine Ikeatüte sachte auf den Boden gleiten, steige aus meinen Pumps, hinein in meine Zebras und schlurfe zaghaft um Inas Jacke herum, durch die Erdgeschosswohnung. Sie hat vier Zimmer und ein geräumiges Wohnzimmer mit einer modernen Kochinsel mitten im Raum, die aussieht wie eine unbenutzte Attrappe. Hochglanz weiß, mit einer dunklen glänzenden Granitsteinplatte. Es riecht nach Duftkerzen – künstliche Vanille. So, wie beim letzten Mal. Auch die unzähligen weißen Buddhafiguren starren mich wieder aus den Regalen heraus an. Es ist geräumig, und anders als Zuhause steht nicht überall etwas herum, sodass man nicht das Gefühl haben muss im Chaos zu ersaufen. An dem geräumigen Wohnzimmer befindet sich eine Terrasse mit einem kleinen Gartenstück, das ganz im japanischen Stil aus Bambuspflanzen und weißen Kieseln besteht. Und noch mehr weißen Buddhas. Die Zimmerwände sind ebenfalls weiß - fehlt hier etwa die Tapete? Der Boden ist - wen überrascht´s - mit weiß-grauen Holzdielen belegt, die im Vergleich zu den alten Eichedielen meiner Eltern makellos scheinen. Alles scheint makellos und akkurat seinen Platz zu haben. Nichts fliegt herum. Nicht einmal ein Geschirrspültuch hängt in der Küche. Dafür fehlt eine entscheidende Sache: Gemütlichkeit. Zwischen den wenigen hellen Möbeln stehen – wie ein gewollter Farbklecks – halbleere Sektgläser und Weinflaschen mit bunten Etiketten.
Ich betrachte sie neugierig und in Ruhe. Eins nach dem anderen. Riesling, Winzer Egli. Der Weinbedarf meiner Vermieterin scheint … groß zu sein, stelle ich fest und versuche es nicht zu bewerten. Doch ich finde, bei aller Liebe, eine gesunde Dosis dürfte dabei nicht überschritten werden.
Oder doch?
Testweise rieche ich an einer offenen Flasche. Dann an der nächsten. Und rümpfe die Nase. Nein, ich fühle mich zu jung für diesen Fusel.
Zweifel beschleichen mich. Mal wieder.
Ich kralle die Fingerspitzen in meine Oberarme.
Stelle ich mir so Annas Leben in der Großstadt vor?
Besser gesagt: Stellt Johannes mich so in seinen Träumen vor?
Zugegeben, so luxuriöse Wohnungen kenne ich sonst nicht. Doch schon vom bloßen Hinschauen bekomme ich Ideen, was ich schleunigst in meinem Leben ändern sollte. Ich lebe zurzeit mit meinen Eltern in einem charmanten, aber kleinen fliederfarbenen Haus mit grünen Klappläden. Unten hatte Zeit meines Lebens meine Großmutter gewohnt und oben wir. Erst als ich ausgezogen bin, um bei Johannes einzuziehen, und Omi ins Heim zog, hatten meine Eltern beschlossen, das Haus nach über fünfzig Jahren zu renovieren. Johannes´ erste Worte damals waren, dass es von jetzt auf gleich zum schönsten Haus in der Straße wurde, - und er hatte Recht. So, wie er immer recht hat. Und genau das wird er auch über mich sagen, wenn wir uns nach meinem Praktikum das nächste mal begegnen werden. Ich merke, wie mir meine Mascara verläuft, und wische mir die Tränen aus den Augenwinkeln.
Ich fühle mich schlagartig so weit weg von Zuhause und habe den Eindruck, dass der schicke Boden unter meinen Zebras droht nachzugeben. Ob ich nicht doch besser hätte bleiben sollen, wo ich zeit meines Lebens hingehörte? Nicht jeder kann für Großes bestimmt sein. Ich taumele durch das Wohnzimmer, ohne zu wissen wohin, und suche etwas Vertrautes, das ich zur Beruhigung fokussieren kann, und entdecke eine verwelkte Zimmerpflanze auf dem Fensterbrett. Eine Stathiphyllum, mitten in der Großstadt. Die haben wir auch zuhause, denke ich und erkenne mich auf eine erschreckende Art und Weise in ihr wieder. Ich zupfe zum Trost bedächtig ein braunes Blatt nach dem anderen ab. Dabei bekomme ich gar nicht mit, dass zwischenzeitlich jemand den Raum betreten hat.
»Du? Wieso wundert mich das nicht«, höre ich.
Ertappt drehe ich mich um die eigene Achse, als hätte ich etwas Verbotenes getan. Und verdrehe schlagartig die Augen. Das, was ich sehe – besser gesagt: die Person – sehe ich heute nämlich nicht zum ersten Mal. Hilfe, ob er mich stalkt? »Arian? Was machst du denn hier?«
»Dir beim Blätterzupfen zuschauen, das siehst du doch. Jetzt verstehe ich auch, weshalb sie unter all den Bewerbern ausgerechnet dich als Untermieterin ausgewählt hat.« Arian öffnet den Kühlschrank, um ihn kurz darauf mit einem Halbfett-Bio-Yoghurt in der Hand wieder zu schließen.
Ich wende mich von der Pflanze ab und schiebe meine Arme hinter den Rücken. »Wieso? Ist Blätterzupfen so was Ungewöhnliches?«
»Glaube mir, das ist es.«
Ich beobachte, wie Arian sich durch diverse Schubladen arbeitet, ehe er einen kleinen Löffel gefunden hat.
»Man sollte eine Stathiphyllum nicht einfach eingehen lassen«, sage ich mit ernster Stimme.
»Sagt wer?«
»Sag mir lieber, was du hier machst?«
»Wohnen. Zumindest immer dann, wenn mir danach ist.« Der Löffel verschwindet erst im Yoghurtbecher, dann in seinem Mund. Er lutscht ihn genüsslich ab.
»Wohnen? Hier?« Über diese Information muss ich ernsthaft einen Moment lang nachdenken. »Hier wohnen mehr als nur meine Vermieterin und ich?«
»Ich sagte, ich wohne hier, wenn mir danach ist. Du verstehst?«
Wenn ihm danach ist?
Wonach?
Nach Ina, der Vermieterin?
Ja, ich beginne zu verstehen und suche peinlich berührt nach den richtigen Worten. Ich suche eigentlich immer danach, schließlich bin ich Texterin und habe schon als Kleinkind Worte wie Sabotage gekannt, doch etwas hält mich gerade davon ab. Es ist diese schmerzvolle Leere, die mein Denken immer dann blockiert, wenn es um Beziehungen geht, und die sich anfühlt, als könnte nur einer sie füllen. Verdammt, er fehlt mir, er fehlt mir so unsäglich.
Arian und ich sehen uns schweigend an.
Als er seinen Yoghurt geleert hat und ein Grinsen unterbindet, vermutlich wieder mal wegen meiner Zebras, werde ich mir der Lächerlichkeit meines melancholischen Gemüts bewusst. Hastig schnappe ich mir mit einem knappen »Ich pack dann mal aus« meine Sachen und verziehe mich wortlos in mein neues Zimmer.
Fünfzehn Quadratmeter.
Zumindest stand das in der Anzeige. Ein großer, weißer Spiegelschrank an der Wand. Gegenüber ein weißes Futonbett. Ein dazu passender Nachttisch und eine unechte Zimmerpflanze aus Plastik, die von einer ausgefallenen Deckenlampe angestrahlt wird. Große bodentiefe Fenster, keine Gardinen. Keine Bilder an den Wänden. Es wirkt steril, wie in einer Klinik, nur schöner, so, wie ich es mir für mein besseres Ich ausgemalt habe: Aufgeräumt.
Ehe ich wieder in das tiefe, schwarze Loch falle, stelle ich den Bilderrahmen, der sonst zuhause auf dem Nachttisch über mich wacht, behutsam neben das Bett.
Johannes sieht atemberaubend gut aus auf dem Bild.
Bis heute weiß ich nicht, wieso er ausgerechnet mich damals dazu eingeladen hatte, mit ihm in sein Baumhaus zu klettern. Da waren wir zehn. Unser erster Kuss schmeckte nach Hubabuba und unser zweiter, fünf Jahre später, nach Tabak und Fanta Pink Grapefruit. Für mich war es eine logische Folge gewesen, dass unser letzter nach Coregataps schmecken würde. Johannes hat mir alles bedeutet. Nur durch seine ständige Kritik an mir und meiner Ziellosigkeit, habe ich mein Abitur und anschließend das Philologiestudium überhaupt in Erwägung gezogen. Jo schlug bis zum Schluss immer wieder vor, ich solle mich als Texterin neu bewerben, - Düsseldorf - Berlin - London - die Welt erkunden und mir berufliche Ziele setzen.
Aber ich brauche keine Ziele, ich brauche Jo.
Ich kapiere nicht, wieso er das nicht kapiert? Er ist doch sonst der Vernünftige von uns beiden.
Ich seufze ausgedehnt.
Wehmütig stehe ich vom Bett auf, ziehe den engen Rock aus und verfrachte ihn auf Nimmerwiedersehen in den Kleiderschrank. Den biederen Blazer gleich mit. Ich durchwühle meinen Koffer und stelle zum wiederholten Male fest, dass ich offensichtlich fast nur Fummel gekauft habe und entsprechend aufgeschmissen bin. Der Versuch, schön zu sein, ist wirklich eine Last. Frustriert fingere ich die neuen Röhrenjeans und einen blassgrünen, asymmetrisch geschnittenen Oversize-Pullover aus dem Koffer, der mir für eine hippe Werbeagentur angemessen erschien. Besser gesagt: der Verkäuferin. Hoffentlich liegt sie damit dieses Mal richtig. Ich ziehe die Jeans über meine neue Spitzenunterwäsche, meine beste Unterwäsche – erstanden in einem Laden, von dem ich nicht einmal wusste, dass derartige Läden überhaupt existieren –, dann schlüpfe ich in den Pullover. Und betrachte mich in dem großen Spiegel meines Kleiderschranks. Vergebens warte ich auf ein zufriedenes Gefühl.
Ja, so jemand, wie Ina, ist außergewöhnlich. Und wird geliebt.
Obgleich ich infrage stelle, dass man von äusserlicher Schönheit auf wirklich wichtige Werte wie Freundschaft und Treue schließen kann. Dennoch möchte ich es nicht ausschließen und gerne wieder für Jo … aufregend und schön sein.
Ich halte einen Moment inne und lasse meinen Blick zu meinem Koffer wandern. »Ach, die Hose kneift doch sowieso«, blaffe ich meinen Koffer motzig an, gehe auf alle Viere und plündere meinen Süßigkeitenvorrat. Als ich mit gefühlten sechshundert Pfund mehr auf den Hüften wenig später wieder raus auf den Flur trete, ist Arian gerade dabei die Spülmaschine auszuräumen. Dabei bemerke ich, dass es wie zuhause bei mir in Sommerkahl angenehm fruchtig nach Tee duftet.
»Ist zufällig noch eine Tasse übrig?«, frage ich und schiebe die Fingerspitzen in die Hosentaschen meiner Jeans, um meine Baumwollhandschuhe zu verstecken, die ich seit der Trennung nicht mehr ablegen kann, und lehne mich gegen die Kochinsel. Dabei beobachte ich, wie Arian das asiatisch anmutende Geschirr sortiert, als habe es etwas Zwanghaftes. Dunkle Tasse zu dunkler Tasse, heller Teller zu hellem Teller, bunte Schälchen zu bunten Schälchen. So, wie ich es ganz vielleicht auch tun würde.
»Du fragst dich sicher, warum ich es nach Farben sortiere«, sagt Arian, als hätte er wieder in meinen Gedanken gelesen. »Es hat ganz harmlos mit den CD´s und Büchern meiner Eltern angefangen, als ich noch klein war, ehe ich es auf Geschirr ausgedehnt habe.«
»Im Ernst?«
»Eigentlich nicht, nein. Das sollte ein Scherz sein.«
»Klar, verstehe.«
»Dafür probier ich beinahe zwanghaft immer wieder etwas Neues aus. Ich denke, jeder hat so seine Macken.«
»Tja«, sage ich, »ich schätze, zwanghaft neues auszuprobieren wäre verglichen mit meinem Problem geradezu niedlich.« Kaum habe ich den Satz zu Ende gesprochen, wird mir heißkalt im Wechsel.
Problem?
Habe ich ernsthaft gesagt, ich hätte ein Problem?
Verlegen schiebe ich meine behandschuhten Hände tiefer in die Taschen.
Arian wirft einen kurzen Blick auf sie und lässt den peinlichen Moment glücklicherweise wortlos vorüberziehen, ehe er erst die Tasse Tee und dann sich selbst gelassen neben mich stellt.
»Ich wusste doch, da gibt es eine Geschichte. Was genau ist denn dein Problem?«, fragt Arian wie selbstverständlich und schlürft gelassen seinen Tee.
»Nicht wichtig.« Ich streife mir zögerlich den rechten Handschuh ab. Dann schaue ich meine Tasse an, gehemmt, sie zu greifen. Besser gesagt, blockiert. Wut kocht in mir hoch, denn ich habe mein Desinfektionsmittel nicht zur Hand. Meine Handknöchel stehen weiß hervor. Ich lächele künstlich. »Eine Sonnenburg hat außerdem keine Probleme, und wenn doch, dann trägt sie sie nicht an den Arbeitsplatz – das hat meine Großmutter zumindest immer gesagt, als sie noch klar denken konnte. Sorry, ich schätze, das gilt auch für WG´s.«
»Und was sagst du?«
»Ich?«
»Ja, du. Ich gehe mal davon aus, jemand mit einem so eigensinnigen Schuhgeschmack hat auch eine eigene Meinung.«
»Die habe ich auch, auf den ersten Blick zumindest, doch wenn man genauer hinschaut, sind Leute wie ich in der Regel leider gewöhnlicher als sie scheinen.«
»So sehr, dass sie ständig in dritter Person von sich sprechen müssen? Wovor hast du Angst?«
»Angst?« Das Wort kommt nach Problem wie ein überraschender Donnerschlag nach einem Blitz und das direkt in die Magengrube. Ich wirbele wie eine Vierjährige zu ihm herum und fahre ihn an ohne nachzudenken. »Ich möchte nicht darüber reden, hörst du?«
»Das sehe ich«, sagt Arian mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Okay, fein. Raus damit! Was soll mir dein Blick sagen?«
»Weiß nicht. Dein Tee wird kalt?«
»Er sagt: Dein Tee wird kalt?«
»Natürlich nicht. Du bist doch eine Frau, wieso liest du nicht zwischen den Zeilen?«
»Wieso hörst du nicht auf, so eine Nervensäge zu sein? Scheinbar fehlt es dir nicht nur an einem Bügeleisen.«
Noch bevor Arian etwas erwidern kann, drehe ich ihm den Rücken zu und sage bemüht monoton: »Danke für den Tee. Ist irgendwie nicht meine Sorte.« Kurz darauf lasse ich die Zimmertür hinter mir ins Schloß fallen. In meinem Bett rolle ich mich in meine Bettdecke und ziehe sie tief ins Gesicht. Sie riecht so schrecklich vertraut. Ich versuche an die früheren Sommertage mit Jo zu denken, wo wir uns zu Löwenzahn und Butterblumen unter die Kirschbäume meiner Eltern gelegt haben. Als unsere Welt noch in Ordnung war. Dabei weiß ich bereits: Noch beinahe die halbe Nacht lang werde ich die Frage in meinem Kopf haben, wovor ich eigentlich Angst habe. Natürlich kenne ich die Antwort darauf: Jo und unseren Kirschbaum für immer verloren zu haben. Aber irgendwie scheint das ganz plötzlich nicht mehr alles zu sein. Sobald der Handywecker leise unser Lied spielen wird, weiß ich, dass bloß ein weiterer Tag vor mir liegt, der ohne ihn sein wird. Er beginnt mit verheulten, aufgequollenen Augen und er endet damit. Ich ziehe schniefend die Nase hoch. Ja, der Umgang mit meinem Liebeskummer wurde in der Zwischenzeit zu meinem eigentlichen Problem. Ich trage Handschuhe, weil mein Ring nicht mehr da ist, wo er hingehört, und ich Angst habe, dass alles so schrecklich bleibt, wie es ist, oder schlimmer noch: dass sich mein Leben nie wieder normal anfühlen wird.